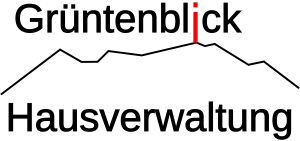Das Urteil klärt die rechtlichen Ansprüche auf die erstmalige Errichtung von Gemeinschaftseigentum in einem sogenannten steckengebliebenen Bauvorhaben. Der Anspruch besteht grundsätzlich, wird jedoch durch Treu und Glauben begrenzt, wenn er den übrigen Wohnungseigentümern unzumutbar ist. Zudem ist § 22 WEG auf solche Fälle nicht analog anwendbar.
1. Kernaussage des Urteils
Der BGH entschied, dass ein Anspruch auf die erstmalige Errichtung von Gemeinschaftseigentum gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 1 WEG besteht, solange die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) besteht. Dieser Anspruch wird jedoch durch den Grundsatz von Treu und Glauben begrenzt, wenn die Erfüllung des Anspruchs für die übrigen Wohnungseigentümer nach den Umständen des Einzelfalls unzumutbar ist. Eine analoge Anwendung von § 22 WEG, der den Wiederaufbau eines zerstörten Gebäudes regelt, ist auf solche Bauvorhaben ausgeschlossen.
2. Tatbestand
- Die Klägerin, Mitglied der GdWE, fordert die Errichtung des Gemeinschaftseigentums eines steckengebliebenen Bauprojekts.
- Das Grundstück sollte ursprünglich mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaut werden, doch die Arbeiten kamen nach Abriss der bestehenden Immobilie zum Stillstand.
- Die Generalbauunternehmerin ging in Insolvenz, und die übrigen Eigentümer lehnten eine Finanzierung der Fertigstellung ab.
- Die Klägerin wollte per Beschlussantrag u.a. die Einholung von Kostenschätzungen und die Durchführung von Abriss- und Bauarbeiten durchsetzen, was in der Eigentümerversammlung abgelehnt wurde.
- Vorinstanzen: Das Amtsgericht wies die Klage ab, das Landgericht setzte einen Beschluss über die Einholung eines Gutachtens zu den Kosten durch.
3. Entscheidungsgründe
- Grundsatz des Anspruchs: Jeder Wohnungseigentümer kann die erstmalige plangerechte Errichtung des Gemeinschaftseigentums verlangen. Dies dient der ordnungsmäßigen Verwaltung und ist unabhängig vom Fertigstellungsgrad des Gebäudes.
- Begrenzung durch Treu und Glauben (§ 242 BGB): Der Anspruch entfällt, wenn die Erfüllung für die übrigen Eigentümer unzumutbar ist, etwa durch unverhältnismäßige Kosten oder wirtschaftliche Belastungen.
- Nichtanwendung von § 22 WEG: Der steckengebliebene Bau unterscheidet sich von einem zerstörten Gebäude, da die Fertigstellungskosten in der Regel kalkulierbar sind und die Eigentümer noch nicht vollständig investiert haben. Eine Analogie wird vom BGH abgelehnt.
- Tatrichterliche Würdigung: Das Gericht muss eine Gesamtabwägung vornehmen und dabei Aspekte wie Kostensteigerungen, Alternativen (z. B. Verkauf an einen Investor) oder wirtschaftliche Belastungen einzelner Eigentümer berücksichtigen.
4. Urteil
Das Berufungsurteil wurde im Umfang der Anfechtung aufgehoben, da das Berufungsgericht keine abschließende Entscheidung über die Zumutbarkeit der Errichtung getroffen hatte. Der Fall wurde zur neuen Verhandlung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Dabei sind weitere Feststellungen zu den Kosten, der rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeit der Errichtung sowie den wirtschaftlichen Folgen für die Eigentümer zu treffen.
Hinweis: Für diese Zusammenfassung wurde künstliche Intelligenz genutzt. Keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hier veröffentlichten Inhalte. Jede Haftung wird ausgeschlossen.