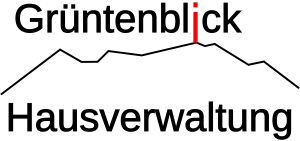Der BGH entschied, dass bei der Genehmigung baulicher Veränderungen (hier: Klimaanlage) grundsätzlich nur die unmittelbaren Auswirkungen berücksichtigt werden müssen, nicht aber mögliche spätere Immissionen. Eine unbillige Benachteiligung liegt nur dann vor, wenn die negativen Folgen der Nutzung evident sind. Trotz Genehmigung bleiben Unterlassungsansprüche bei späteren Störungen möglich.
1. Kernaussage des Urteils
Die Genehmigung baulicher Veränderungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ist grundsätzlich zulässig, wenn keine evidente unbillige Benachteiligung anderer Wohnungseigentümer vorliegt. Dabei sind allein die mit der baulichen Maßnahme unmittelbar verbundenen Auswirkungen maßgeblich – nicht aber potenzielle Immissionen aus deren Nutzung (z. B. tieffrequenter Schall bei Klimaanlagen). Gegen nachträgliche Störungen können sich betroffene Eigentümer gesondert zivilrechtlich wehren.
2. Tatbestand
Die Klägerin ist Wohnungseigentümerin im vierten Obergeschoss einer Wohnanlage. Der Eigentümer der Penthouse-Wohnung im achten Obergeschoss erhielt durch Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft (GdWE) die Genehmigung, auf eigene Kosten eine Split-Klimaanlage einzubauen. Der Beschluss regelte die genaue Platzierung sowie die technische Ausführung (z. B. Körperschallentkopplung durch Dämpfsockel).
Die Klägerin erhob Anfechtungsklage gegen den Beschluss, da sie sich durch mögliche tieffrequente Schallemissionen unzumutbar beeinträchtigt sah. Amts- und Landgericht wiesen die Klage ab. Die Klägerin verfolgte ihr Ziel mit der zugelassenen Revision weiter.
3. Entscheidungsgründe
a. Prüfung der Maßstäbe nach § 20 Abs. 4 Alt. 2 WEG
- Maßgeblich ist, ob durch die bauliche Veränderung eine unbillige Benachteiligung entsteht. Dies erfordert eine objektive Abwägung zwischen Nachteilen und Vorteilen für die Betroffenen.
- Eine Beeinträchtigung liegt nur dann vor, wenn ein verständiger Wohnungseigentümer diese in objektiver Weise nicht hinnehmen müsste.
b. Keine Einbeziehung der Nutzungseffekte in die Prüfung
- Auswirkungen der späteren Nutzung (z. B. Geräuschemissionen beim Betrieb) sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, es sei denn, deren negative Folgen drängen sich bereits bei Beschlussfassung evident auf.
- Nur bei klar vorhersehbarer unzumutbarer Belastung (z. B. Klimagerät direkt vor einem Schlafzimmerfenster bei alternativ möglicher Anbringung) könnte dies anders gewertet werden.
c. Umgang mit nachträglichen Beeinträchtigungen
- Ein bestandskräftiger Gestattungsbeschluss schließt spätere zivilrechtliche Abwehransprüche anderer Eigentümer (z. B. Unterlassung nach § 1004 BGB) nicht aus.
- Der störende Eigentümer bleibt verpflichtet, etwaige Beeinträchtigungen (Immissionen) zu unterlassen oder zu mindern.
- Meist genügt eine zeitliche Begrenzung oder technische Nachbesserung (z. B. Ruhezeitenregelung).
d. Keine Pflicht zu flankierenden Regelungen bei Beschlussfassung
- Die GdWE muss nicht gleichzeitig mit der Gestattung Nutzungsregelungen treffen (z. B. Betriebszeiten).
- Solche Regeln können später durch die Hausordnung nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 WEG ergänzt werden.
e. Gesetzgeberische Intention (WEMoG)
- Ziel des Gesetzgebers war es, bauliche Maßnahmen zu erleichtern und Modernisierungen zu ermöglichen.
- Eine zu frühe Berücksichtigung hypothetischer Nutzungsfolgen würde dieses Ziel unterlaufen.
- Daher ist es legitim, die Genehmigung auf Grundlage der baulichen Maßnahmen selbst zu erteilen und die Nutzung ggf. im Nachhinein zu regulieren.
f. Anwendung auf den Streitfall
- Der befürchtete tieffrequente Schall war nicht objektiv vorhersehbar oder evident benachteiligend.
- Die Klägerin wohnt drei Etagen unter dem Gerät, und dieses soll auf schalldämpfenden Sockeln montiert werden.
- Die TA Lärm-Grenzwerte werden eingehalten, eine Prognose tieffrequenter Schallimmissionen sei methodisch zudem nicht zuverlässig möglich.
- Die Klägerin kann bei nachgewiesener Störung zivilrechtlich vorgehen, wurde durch die Genehmigung jedoch nicht unbillig benachteiligt.
4. Urteil
Die Revision der Klägerin wurde zurückgewiesen. Der BGH bestätigt die Entscheidung der Vorinstanzen und stellt klar, dass der Gestattungsbeschluss ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht. Der Einbau der Klimaanlage ist zulässig, da keine evident unzumutbare Belastung vorliegt.
Ein Sachverständigengutachten war nicht einzuholen, da für eine zuverlässige Prognose tieffrequenter Schallimmissionen keine gesicherten wissenschaftlichen Methoden existieren. Die Klägerin kann sich im Fall tatsächlicher Störungen gegen den Betrieb zur Wehr setzen, doch verhindert dies nicht die bauliche Maßnahme selbst.
Hinweis: Für diese Zusammenfassung wurde künstliche Intelligenz genutzt. Keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hier veröffentlichten Inhalte. Jede Haftung wird ausgeschlossen.