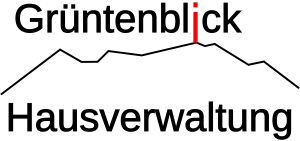Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Bauträger, der bauliche Veränderungen während der Errichtungsphase einer Wohnanlage vornimmt, nicht als Wohnungseigentümer, sondern als Werkunternehmer handelt. Werdende Wohnungseigentümer haben in dieser Phase keine Beseitigungsansprüche wegen planwidriger Bauausführungen. Solche Ansprüche sind vertraglich zu klären, nicht wohnungseigentumsrechtlich.
1. Kernaussage des Urteils
Das Urteil stellt klar: Während der Errichtungsphase handelt ein Bauträger nicht als Wohnungseigentümer, sondern als Vertragspartner mit werkvertraglichen Pflichten gegenüber den Erwerbern. Daher können werdende Wohnungseigentümer keine Ansprüche aus § 1004 BGB (Beseitigung von Störungen) in Verbindung mit dem WEG geltend machen, selbst wenn der Bauträger zugleich noch Eigentümer einzelner Einheiten ist. Etwaige Abweichungen von der ursprünglichen Planung sind ausschließlich vertraglich zu bewerten, nicht wohnungseigentumsrechtlich.
2. Tatbestand
Die Parteien bilden eine Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE). Die Beklagte ist Bauträgerin und errichtete auf einem geteilten Grundstück eine Wohnanlage, wobei sie selbst weiterhin Eigentümerin einer gewerblich genutzten Einheit ist. Im Zuge der Bauarbeiten installierte sie dort u.a. eine Lüftungsanlage, ein Kühlaggregat und einen Flüssiggastank, ohne dass diese in der Teilungserklärung oder Baubeschreibung vorgesehen waren. Die Kläger – werdende Wohnungseigentümer – hatten zu diesem Zeitpunkt bereits Auflassungsvormerkungen, teilweise auch Besitz an den Einheiten. Sie klagten auf Beseitigung dieser baulichen Veränderungen.
Das Amtsgericht wies die Klage ab, das Landgericht hingegen gab ihr statt. Der BGH hob auf Revision der Beklagten das Urteil des Landgerichts auf.
3. Entscheidungsgründe
a) Unzulässigkeit der Berufung eines Klägers
Der BGH wies die Berufung des Klägers zu 1 als unzulässig zurück, da sich dieser in seiner Berufungsbegründung nicht mit allen tragenden Erwägungen des amtsgerichtlichen Urteils auseinandergesetzt hatte. Er hatte zum Zeitpunkt der Einbauten keinen Besitz an seiner Einheit und somit keine Aktivlegitimation – ein tragender Ablehnungsgrund, den er nicht angegriffen hatte.
b) Keine wohnungseigentumsrechtlichen Beseitigungsansprüche
Die Kläger zu 2 und 3 waren zwar zum Zeitpunkt der Klage prozessführungsbefugt, weil die alte Rechtslage (vor dem WEMoG) Anwendung fand und das Verfahren vor dem 1. Dezember 2020 eingeleitet wurde. Dennoch bestehen keine Ansprüche nach § 1004 BGB i.V.m. § 22 WEG aF:
- Grundsatz: Auch werdende Wohnungseigentümer können im Innenverhältnis gewisse Rechte geltend machen, wenn sie eine rechtlich verfestigte Erwerbsposition haben (Auflassungsvormerkung + Besitz).
- Grenze: Baut der Bauträger während der Errichtungsphase entgegen der Planung, begründet das keine rechtswidrige Eigentumsbeeinträchtigung, sondern lediglich vertragliche Ansprüche.
- Begründung: Der Bauträger handelt bei der Errichtung als Erfüllungsgehilfe im Rahmen seiner schuldrechtlichen Pflichten, nicht als Wohnungseigentümer. Seine Handlungen fallen daher nicht unter das Regime des § 22 WEG aF (bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum).
- Folge: Abweichungen von der Baubeschreibung oder dem Aufteilungsplan können nicht im Wege wohnungseigentumsrechtlicher Ansprüche verfolgt werden, sondern nur vertraglich.
c) Abgrenzung: Bauphase vs. spätere Eingriffe
Ein zentraler Punkt des Urteils ist die Unterscheidung zwischen:
- Errichtungsphase: Während dieser Phase gelten werkvertragliche Regeln.
- Nach Abnahme: Nach Abschluss der Bauarbeiten und Übergabe des Gemeinschaftseigentums muss der Bauträger sich an wohnungseigentumsrechtliche Vorschriften halten.
Im vorliegenden Fall erfolgten die beanstandeten Einbauten vor der Abnahme des Gemeinschaftseigentums. Die Beklagte hatte erst im August 2017 ein Abnahmeprotokoll übergeben, die strittigen Einbauten waren aber bereits im Juni erfolgt.
d) Abgrenzung zu baulichen Veränderungen nach WEG
Der BGH stellt klar, dass nicht jede planabweichende Bauausführung automatisch eine bauliche Veränderung i.S.v. § 22 WEG aF ist. Vielmehr ist die erstmalige Herstellung der Anlage von solchen baulichen Veränderungen zu unterscheiden. Nur Letztere bedürfen der Zustimmung (bzw. nach neuem Recht: Beschluss) der GdWE.
e) Klarstellung zur bisherigen Rechtsprechung
Der BGH distanziert sich ausdrücklich von einer etwaigen gegenteiligen Interpretation seiner früheren Rechtsprechung (z. B. V ZR 118/13) und betont, dass selbst eine nicht plangerechte Errichtung keine Eigentumsbeeinträchtigung i.S.d. § 1004 BGB darstellt.
4. Urteil
Der BGH hob das Berufungsurteil des LG Frankfurt (Oder) auf, soweit es zum Nachteil der Beklagten erging. Die Berufung des Klägers zu 1 wurde als unzulässig verworfen, die Berufungen der Kläger zu 2 und 3 wurden zurückgewiesen.
Kostenentscheidung:
- Die Kläger tragen die Kosten der Rechtsmittelverfahren.
- Die Kosten erster Instanz werden zu 92 % den Klägern und zu 8 % der Beklagten auferlegt.
Fazit:
Dieses Urteil klärt grundlegend die Abgrenzung zwischen werkvertraglichen Ansprüchen und wohnungseigentumsrechtlichen Beseitigungsansprüchen in der Bauphase einer Wohnanlage. Der teilende Bauträger unterliegt während der Errichtung nicht dem WEG-Regime – selbst wenn planwidrig gebaut wird. Wohnungseigentümer können solche Mängel ausschließlich vertraglich geltend machen.
Hinweis: Für diese Zusammenfassung wurde künstliche Intelligenz genutzt. Keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hier veröffentlichten Inhalte. Jede Haftung wird ausgeschlossen.