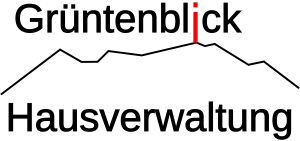Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied, dass ein Vermieter Eigenbedarf geltend machen kann, wenn er seine derzeitige Wohnung umbauen und anschließend verkaufen möchte, sofern er die vermietete Wohnung während und nach den Bauarbeiten selbst nutzen will. Das Berufungsgericht hatte den Eigenbedarf fälschlich als Verwertungskündigung gewertet. Der BGH hob das Urteil des Landgerichts Berlin auf und verwies die Sache zurück.
1. Kernaussage des Urteils
Der BGH stellt klar, dass eine Kündigung wegen Eigenbedarfs (§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB) auch dann zulässig sein kann, wenn der Vermieter seine bisher selbst bewohnte Wohnung umbauen und verkaufen möchte, um währenddessen und dauerhaft die vermietete Wohnung selbst zu nutzen. Maßgeblich ist, dass der Eigenbedarf auf ernsthaften, vernünftigen und nachvollziehbaren Gründen beruht – nicht, dass der Vermieter auf die Wohnung „angewiesen“ ist. Eine bloße Verkaufsabsicht macht den Eigenbedarf nicht automatisch zu einer Verwertungskündigung nach § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB.
2. Tatbestand
Die Beklagte war seit 2006 Mieterin einer Zweizimmerwohnung in einem Berliner Mehrparteienhaus. Der Kläger, der Eigentümer dieser Wohnung geworden war, bewohnte die direkt darüberliegende, ähnlich große Wohnung im vierten Obergeschoss. Darüber befand sich ein nicht ausgebautes Dachgeschoss, das ebenfalls dem Kläger gehörte.
Im November 2021 kündigte der Kläger das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs zum 31. Juli 2022. Begründung: Er wolle das Dachgeschoss ausbauen und mit seiner eigenen Wohnung verbinden. Während der mehrmonatigen Bauphase könne er seine Wohnung nicht bewohnen und benötige deshalb die von der Beklagten bewohnte Wohnung im dritten Obergeschoss. Nach Abschluss der Bauarbeiten wolle er die umgebaute obere Wohnung verkaufen und dauerhaft in die nun frei werdende Wohnung im dritten Obergeschoss einziehen.
Das Amtsgericht Charlottenburg gab der Räumungsklage statt und sah den Eigenbedarf als begründet an. Das Landgericht Berlin hob das Urteil auf Berufung der Mieterin hin auf: Es sah keinen echten Eigenbedarf, sondern eine Verwertungskündigung (§ 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB), da das Ziel des Vermieters die wirtschaftlich lukrative Veräußerung der umgebauten Wohnung sei. Das Landgericht bewertete das Vorgehen des Vermieters als rechtsmissbräuchlich, weil seine Wohnverhältnisse durch den Umzug faktisch gleichblieben.
Der Kläger legte Revision beim BGH ein und beantragte die Wiederherstellung des amtsgerichtlichen Urteils.
3. Entscheidungsgründe
a) Maßstab der rechtlichen Prüfung (§ 573 BGB)
Der BGH erläutert, dass eine ordentliche Kündigung des Vermieters nur bei berechtigtem Interesse (§ 573 Abs. 1 Satz 1 BGB) zulässig ist. Ein solches liegt insbesondere vor, wenn der Vermieter die Wohnung für sich, Familienangehörige oder Haushaltsangehörige benötigt (§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB).
Die Gerichte müssen bei der Anwendung dieser Vorschrift die Eigentumsrechte beider Seiten (Art. 14 Abs. 1 GG) wahren und einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Nutzungsinteresse des Vermieters und dem Bestandsschutzinteresse des Mieters finden.
b) Begriff des „Benötigens“
Der Vermieter muss nicht „auf die Wohnung angewiesen“ sein. Ein vernünftiger, nachvollziehbarer und ernsthafter Wunsch zur Selbstnutzung reicht aus. Die Gerichte dürfen ihre eigene Einschätzung des angemessenen Wohnbedarfs nicht an die Stelle des subjektiven, aber nachvollziehbaren Lebensplans des Vermieters setzen.
Der Eigenbedarf ist nur dann rechtsmissbräuchlich, wenn er offensichtlich vorgeschoben, überhöht oder widersprüchlich ist – etwa wenn eine andere geeignete Wohnung verfügbar wäre oder die behaupteten Gründe nicht glaubhaft sind.
c) Fehler des Berufungsgerichts (LG Berlin)
Das Landgericht Berlin hatte die Kündigung zu Unrecht als Verwertungskündigung gewertet. Nach Auffassung des BGH war die Begründung des Klägers – Umbau und Verkauf der eigenen Wohnung, Nutzung der Mietwohnung als Ersatz und späterer dauerhafter Wohnsitz – ein zulässiger und nachvollziehbarer Grund im Sinne des § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB.
Die Annahme des Landgerichts, dass es sich wegen der Verkaufsabsicht um eine wirtschaftliche Verwertung (§ 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB) handele, sei unzutreffend. Der Kläger wolle die Mietwohnung nicht veräußern, sondern selbst bewohnen. Der geplante Verkauf betreffe eine andere, nicht vermietete Einheit, weshalb § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB nicht einschlägig sei.
d) Keine Rechtsmissbräuchlichkeit
Dass der Kläger seine Situation selbst herbeigeführt hat (Umbau und anschließender Verkauf der eigenen Wohnung), schließt den Eigenbedarf nicht aus. Auch ein selbstverursachter Wohnbedarf kann nach der ständigen Rechtsprechung des BGH (vgl. VIII ZR 180/18, VIII ZR 144/19) Eigenbedarf begründen, solange er nachvollziehbar und ernsthaft ist.
Das Berufungsgericht habe daher den Kern des klägerischen Vortrags verkannt und seine Motive nicht ausreichend gewürdigt. Die bloße Tatsache, dass die neue Wohnung ähnlich groß sei, begründe keine Unangemessenheit oder Missbrauch. Das Gesetz verlange keine wesentliche Veränderung der Wohnverhältnisse.
e) Verhältnis zwischen Eigenbedarf und Verwertungskündigung
Die beiden Tatbestände (§ 573 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BGB) sind klar zu trennen.
- § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB: Eigenbedarf – Schutz des Vermieters als Eigentümer, der selbst nutzen will.
- § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB: Wirtschaftliche Verwertung – wenn der Vermieter an einer angemessenen wirtschaftlichen Nutzung des Eigentums gehindert ist.
Im vorliegenden Fall ging es dem Kläger nicht um die Verwertung der Mietwohnung, sondern um deren Selbstnutzung. Der bloße Wunsch, die eigene Wohnung zu verkaufen, steht dem Eigenbedarf an der anderen Wohnung nicht entgegen.
f) Verfassungsrechtliche Würdigung
Der BGH verweist auf Art. 14 GG: Das Eigentumsrecht schützt auch den Entschluss, Wohnraum selbst zu nutzen oder durch Angehörige nutzen zu lassen. Die Entscheidung des Landgerichts verletze diesen Schutz, da sie den legitimen Selbstnutzungswunsch des Eigentümers zu stark einschränke.
Die Gerichte dürfen die Wohnplanung des Eigentümers nicht durch eine objektive Bewertung des „angemessenen Wohnens“ ersetzen.
4. Urteil
Der BGH hob das Urteil des Landgerichts Berlin vom 20. November 2023 auf.
Er entschied, dass die Sache an eine andere Kammer des Landgerichts zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen wird, auch über die Kosten des gesamten Verfahrens (Nichtzulassungsbeschwerde und Revision).
Damit ist das Urteil des Amtsgerichts Charlottenburg, das dem Vermieter die Räumung zugesprochen hatte, noch nicht endgültig wiederhergestellt – das Berufungsgericht muss nun erneut prüfen, ob der Eigenbedarf im konkreten Fall tatsächlich besteht, dabei aber die Maßstäbe des BGH beachten.
Fazit:
Der BGH stärkt mit dieser Entscheidung die Position von Vermietern, die ihre Immobilie umstrukturieren oder verkaufen, aber gleichzeitig eine andere eigene Einheit im selben Haus bewohnen wollen. Solche Konstellationen stellen keine „Verwertungskündigung“ dar, solange der Selbstnutzungswunsch ernsthaft und nachvollziehbar ist. Die Grenze bildet erst der Rechtsmissbrauch, etwa wenn die Kündigung bloß vorgeschoben ist.
Hinweis: Für diese Zusammenfassung wurde künstliche Intelligenz genutzt. Keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hier veröffentlichten Inhalte. Jede Haftung wird ausgeschlossen.